Blog
Wenn das Studium auf die Psyche schlägt
Das Studium an der Universität wird häufig als eine der prägendsten Lebensphasen beschrieben. Es steht für Selbstständigkeit, intellektuelle Freiheit und neue Erfahrungen. Doch während viele diese Zeit mit Neugier und Motivation beginnen, erleben andere sie als emotional fordernd. Zwischen Leistungsdruck, Geldsorgen, Zukunftsängsten und hohen Erwartungen geraten viele Studierende psychisch an ihre Grenzen. Unterschiedliche Einflüsse wie finanzielle Unsicherheit, sozialer Druck, Lärm in überfüllten Lernräumen oder ein hohes Arbeitspensum können sich dabei verstärkend auswirken und Körper wie Psyche belasten. Diese Stressoren führen oft zur Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten und dem Gefühl, nicht mehr mithalten zu können. Im Laufe der Zeit kann das zur Folge haben, dass Motivation und Lebensfreude abnehmen und das Studium zunehmend als Überforderung erlebt wird.
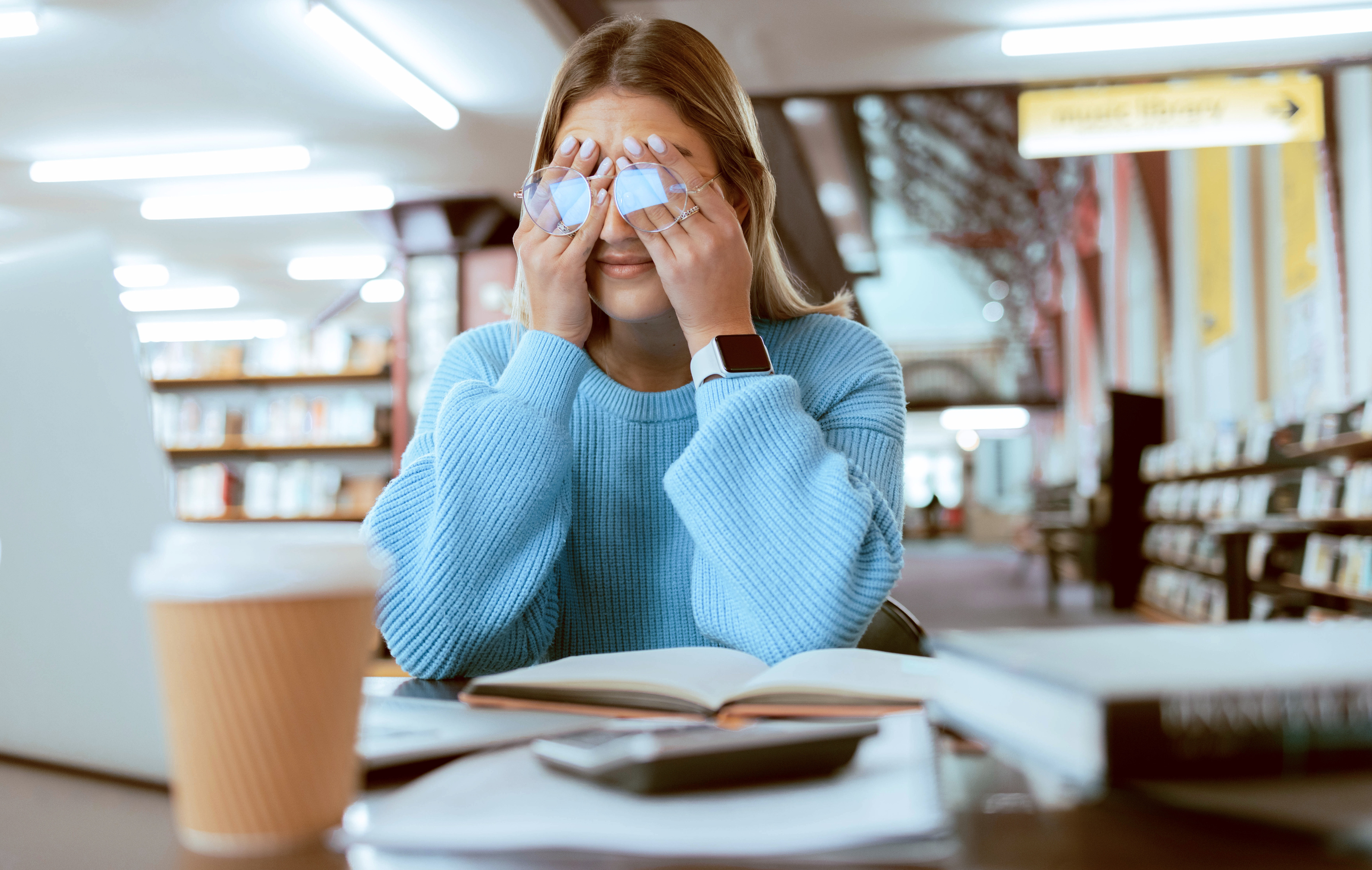
Die Studieneingangsphase: Aufbruch mit Unsicherheit
Der Beginn eines Studiums an der Universität ist für viele ein Schritt in eine neue Welt. Es ist eine Zeit der Gegensätze. Auf der einen Seite stehen Aufbruch, Begeisterung und Hoffnung. Auf der anderen Seite herrschen Unsicherheit, Überforderung und manchmal auch Einsamkeit.
Die Forschung belegt, dass physische und psychische Stressoren unter Studierenden vorhanden sind. Eine österreichische Untersuchung zeigte, dass 35 Prozent depressive Symptome, 21 Prozent körperliche Beschwerden und ebenso gleich viele problematischen Alkoholkonsum angaben. Mehr als die Hälfte berichtete über mittleren oder hohen Stress (Reitter et al., 2022). Diese Zahlen zeigen, dass mentale Gesundheit im Studium kein Randthema ist, sondern eines, das die Mehrheit der Studierenden betrifft.
Viele Studierende starten mit dem Gefühl, dass „jetzt das richtige Leben“ beginnt. Doch schon nach den ersten Wochen kann die Realität anders aussehen. Die Fülle an Informationen, die Umstellung auf eigenverantwortliches Lernen, die Anonymität großer Hörsäle und die Komplexität des Universitätssystems überfordern viele. Aus Neugier wird Druck, aus Motivation wird Erschöpfung. Diese starke Veränderung kann zur Folge haben, dass die anfängliche Begeisterung schnell nachlässt. Stattdessen treten Stress, Zweifel und Erschöpfung auf, welche erste Anzeichen für ein mögliches Burnout ein können. Es ist wichtig, zwischen normaler Erschöpfung und anhaltender, belastungsbedingter Müdigkeit zu unterscheiden.
Orientierung an der Universität
Zu Beginn stehen viele vor Herausforderungen, die den Studierenden neu sind. Eine Krisensituation zu bewältigen, ist für viele Studierende eine neue Erfahrung. Sie müssen zum Beispiel sich in neue Verwaltungssysteme einfinden, Verantwortung übernehmen und neue soziale Beziehungen aufbauen.
Besonders anspruchsvoll ist diese Phase für Erstakademiker:innen, also für Studierende, deren Eltern kein Studium absolviert haben. Ihnen fehlt häufig der familiäre Rückhalt in akademischen Fragen. Während andere auf das Erfahrungswissen ihrer Eltern zurückgreifen können, müssen sie sich viele Dinge selbst aneignen: Wie schreibe ich eine Seminararbeit? Wie gehe ich mit Dozierenden um? Wie beurteile ich meine Leistungen realistisch?
Diese Unsicherheit betrifft nicht nur das Organisatorische, sondern auch die innere Haltung. Viele dieser Studierenden fühlen sich, als müssten sie zwei Welten verbinden: die vertraute Umgebung, in der sie aufgewachsen sind, und die neue akademische Kultur, die eigene Sprache, Verhaltensweisen und unausgesprochene Normen hat. In Gesprächen mit Kommilitoninnen und Kommilitonen oder Lehrenden entsteht manchmal das Gefühl, „nicht richtig dazuzugehören“. Selbst wenn die Leistungen gut sind, bleibt oft die Sorge, irgendwann als „fehl am Platz“ entlarvt zu werden.
Dieser Prozess kann emotional sehr anstrengend sein. Es ist nicht nur das Lernen, das herausfordert, sondern auch das ständige Aushandeln der eigenen Identität. Viele Erstakademiker:innen erleben, dass ihr gewohntes soziales Umfeld ihre neue Lebenswelt nicht versteht. Gleichzeitig fühlen sie sich in akademischen Kreisen noch unsicher. Diese Zwischenposition erzeugt häufig Einsamkeit und Selbstzweifel.
Hinzu kommt ein innerer Druck, alles „richtig“ zu machen. Das Bedürfnis, den Erwartungen der Familie gerecht zu werden, ist groß, auch wenn diese Erwartungen oft unausgesprochen bleiben. Viele möchten zeigen, dass sich ihre Anstrengung lohnt, dass sie „es schaffen“. Dieses Bemühen kann zu einem hohen Leistungsanspruch führen, der langfristig überfordernd wirkt. Wer glaubt, keine Fehler machen zu dürfen, gerät schnell in einen Zustand ständiger Anspannung.
Für viele Erstakademiker:innen ist das Studium an einer Universität deshalb nicht nur eine Bildungsreise, sondern ein tiefer sozialer Übergang. Es verlangt, alte Orientierungsmuster hinter sich zu lassen und neue zu entwickeln. Wer dabei keine Begleitung erfährt, durch Mentoring, psychologische Beratung oder soziale Netzwerke, läuft Gefahr, auf Dauer überfordert zu sein.
Erwartungsdruck und innere Konflikte
Studierende aus Akademikerfamilien erleben häufig andere, aber ebenso belastende Herausforderungen. Wenn Bildung in der Familie einen hohen Stellenwert hat, entstehen oft unausgesprochene Erwartungen: ein bestimmtes Fach zu wählen, rasch erfolgreich in einem Bereich zu sein oder die akademische Laufbahn der Eltern fortzusetzen. Diese Erwartungen müssen nicht einmal ausdrücklich formuliert werden, denn sie sind oft Teil eines familiären Selbstverständnisses. Die Leistungsfähigkeit sollte dabei konstant gut sein. Akademische Traditionen können zur Depression oder zu einem Burnout führen, wenn der Druck zu groß wird.
Viele junge Personen übernehmen diese Erwartungen unbewusst. Sie studieren Medizin, Jus oder Wirtschaft, nicht unbedingt aus Interesse, sondern weil sie glauben, dass es „richtig“ ist oder weil sie die Erwartungen ihrer Eltern nicht enttäuschen möchten. Solche inneren Konflikte können sich leise, aber tiefgreifend auf die psychische Gesundheit auswirken.
Darüber hinaus zeigen Untersuchungen, dass familiäre Erwartungen stark mit dem sogenannten leistungsorientierten Perfektionismus zusammenhängen, also dem inneren Drang, nur dann Wert zu haben, wenn man fehlerfrei und erfolgreich ist (Stoeber & Otto, 2006). Diese Haltung erhöht die Wahrscheinlichkeit für Stress, Burnout und emotionale Erschöpfung erheblich.
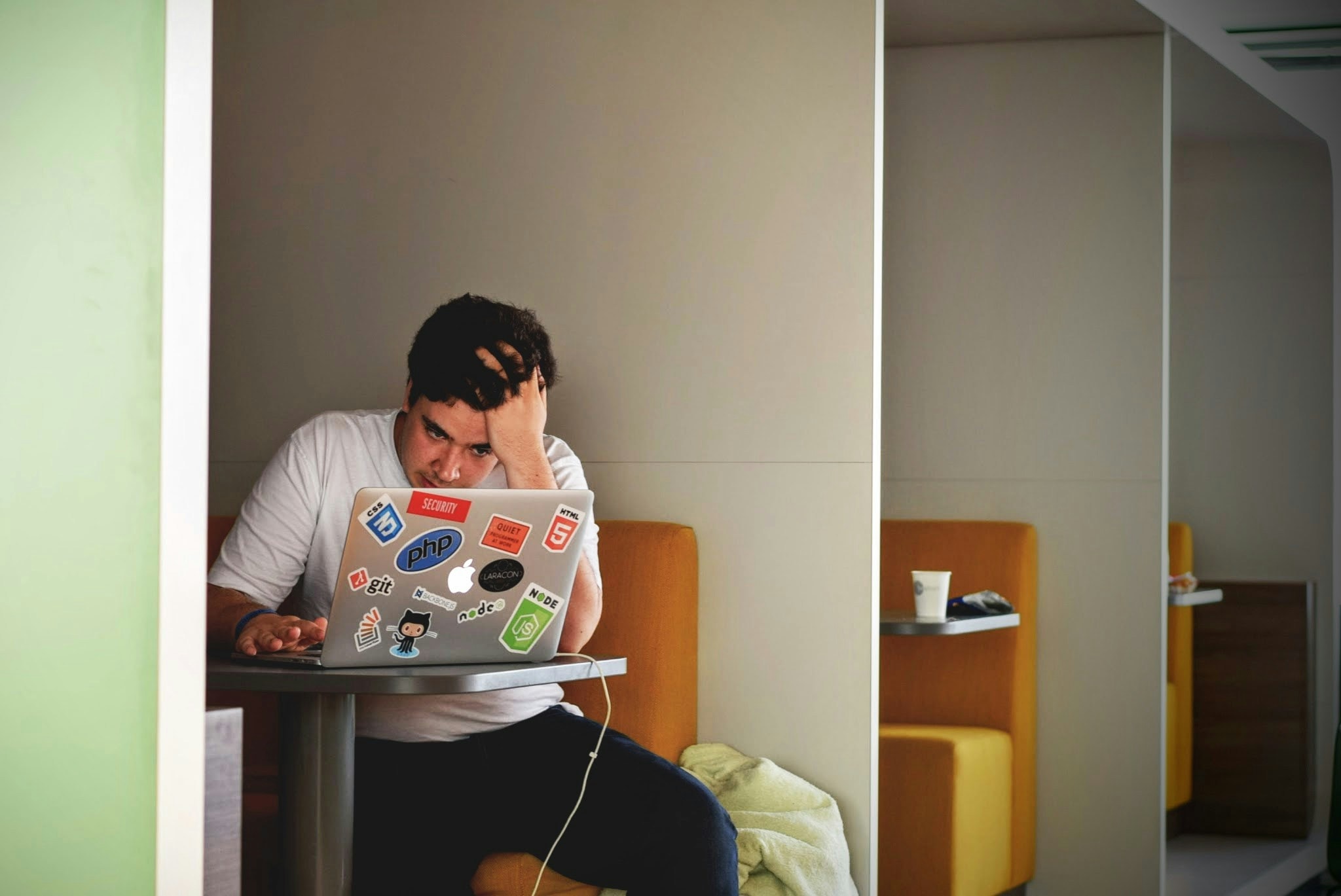
Wer merkt, dass das gewählte Studium nicht zur eigenen Persönlichkeit passt, steht häufig vor einem Dilemma. Auf der einen Seite steht der Wunsch nach Selbstbestimmung, auf der anderen Seite das Bedürfnis nach familiärer Anerkennung. Dieser Widerspruch kann zu Scham oder Versagensangst führen. Viele junge Menschen haben Schuldgefühle, weil ihre Eltern in sie finanziell oder emotional investiert haben (Schröter, 2024).
Solche inneren Spannungen können über längere Zeit das Selbstwertgefühl untergraben. Wenn das Studium nicht den eigenen Interessen entspricht, sinkt die Motivation, Lerninhalte werden als sinnlos erlebt und selbst kleine Misserfolge können starke Selbstzweifel auslösen. Psychologisch gesehen entsteht hier eine sogenannte kognitive Dissonanz: Das eigene Erleben (Unzufriedenheit, Desinteresse) widerspricht dem internalisierten Bild von Erfolg und Leistung (Kirchgeorg, 2018).
Auch gesellschaftliche Dynamiken verstärken diesen Druck. In einer Zeit, in der Erfolg oft an messbare Leistungen geknüpft ist, wird Bildung zum Symbol von Status und Selbstwert. Wer diese Erwartungen nicht erfüllt, hat schnell das Gefühl, „nicht genug“ zu sein. Das kann zu Rückzug, innerer Leere oder depressiver Symptomatik führen.
Gleichzeitig fällt es vielen schwer, offen darüber zu sprechen. Die Angst, als „undankbar“ oder „schwach“ wahrgenommen zu werden, führt oft dazu, dass Studierende Konflikte verdrängen oder sich zurückziehen. Dabei wäre genau in diesen Momenten Unterstützung wichtig. Sei es durch professionelle Beratung, Unterhaltungen mit Vertrauenspersonen oder Austausch mit anderen Studierenden, die ähnliche Erfahrungen machen.
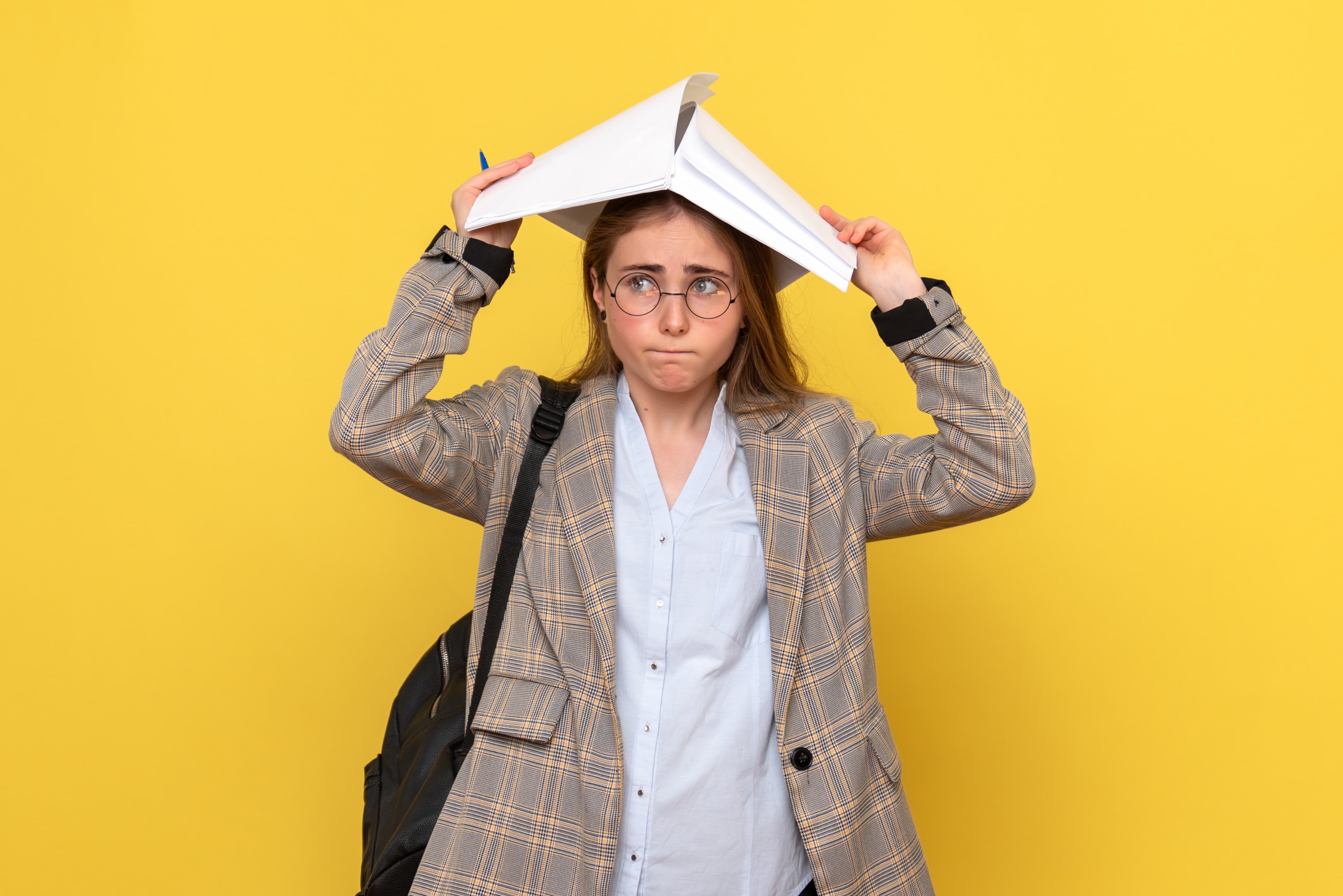
Unterstützung am Anfang
Bereits in dieser Phase kann professionelle Begleitung helfen. Die Psychologische Studierendenberatung bietet österreichweit kostenlose und vertrauliche Hilfe an. Dort können Studierende über Unsicherheiten, Überforderung oder Entscheidungsprobleme sprechen. Sie stellen persönliche Termine, Online- und Telefonberatung sowie psychotherapeutische Unterstützung zur Verfügung. Die Intention ist es, frühzeitig Wege zu finden, um Belastungen zu reduzieren, bevor sie sich verfestigen.
Die Studierendenberatung arbeitet eng mit Fachleuten aus Psychologie, Psychotherapie und Sozialarbeit zusammen, um individuelle Unterstützung anzubieten. Sie versteht sich als wichtige Schnittstelle zwischen Hochschule und Gesundheitssystem und kann bei Bedarf den Kontakt zu medizinischen Einrichtungen oder weiterführenden Angeboten herstellen. Wie, wenn psychische oder psychosomatische Schmerzen auftreten und Rehabilitation oder eine begleitende Behandlung mit Medikamenten sinnvoll erscheint.
Neben dem Standort in Wien ist die Psychologische Studierendenberatung auch in Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz und Salzburg vertreten. Die Beratung richtet sich an Studierende aller Hochschulen, Fachrichtungen und Studienphasen: vom Studienbeginn bis zum Abschluss. Typische Themen sind Unsicherheit bei der Studienwahl, Schwierigkeiten mit Motivation oder Konzentration, Prüfungsangst, Prokrastination, soziale Isolation, Leistungsdruck oder persönliche Problemen. Auch Konflikte zwischen Studium und Familie, Beziehungsthemen oder Zukunftsängste können dort offen angesprochen werden.
Zweck all dieser Angebote ist es, Studierende frühzeitig zu unterstützen, bevor sich Überforderung und Stress verfestigen. Ein zentrales Anliegen der Beratung ist es, gemeinsam mit den Studierenden individuelle Strategien zu entwickeln, um mit Druck, Selbstzweifeln und Unsicherheit umzugehen. Viele berichten schon nach wenigen Sitzungen von Erleichterung, weil sie merken, dass ihre Probleme ernst genommen werden und sie nicht allein sind.
Auch wer nicht sicher ist, ob die Beratung „der richtige Ort“ ist, kann sich dorthin wenden. Die Psychologinnen und Psychologen vor Ort helfen dabei, Anliegen einzuordnen und falls nötig an weitere spezialisierte Einrichtungen weiterzuvermitteln. Mehr Informationen finden sich auf https://www.studierendenberatung.at/standorte/wien/ueberblick.
Die Studienmitte: Zwischen Motivation und Erschöpfung
Mit den ersten erfolgreich absolvierten Semestern beginnt eine neue Phase des Studiums. Der Alltag wird vertrauter, Routinen entstehen und vieles, was anfangs überwältigend wirkte, läuft nun strukturierter ab. Gleichzeitig verändern sich die Herausforderungen. Aus der anfänglichen Aufbruchsstimmung wird ein kontinuierlicher Lernprozess, bei dem Organisation, Selbstdisziplin und Motivation immer wichtiger werden. Viele Studierende finden in dieser Zeit ihren eigenen Rhythmus, lernen, mit Verantwortung umzugehen und merken, dass sie in vielem gewachsen sind.
Doch genau diese Routine kann auch fordernd sein. Zwischen Lehrveranstaltungen, Prüfungen, Nebenjobs und privaten Verpflichtungen fällt es oft schwer, die Balance zu halten. Manche beginnen zu hinterfragen, ob sie im richtigen Fach sind oder was sie wirklich erreichen möchten. Solche Gedanken gehören zur natürlichen Entwicklung dazu. Die Studienmitte ist deshalb nicht nur eine Zeit des Durchhaltens, sondern auch eine Phase der Selbstreflexion. Ein Moment, in dem sich entscheidet, wie man das Studium und die eigene Zukunft weiter gestalten möchte.
Studienzweifel und Identität
In der Mitte des Studiums an einer Universität beginnen viele, ihre ursprünglichen Entscheidungen zu hinterfragen. Anfangs stand die Neugier im Vordergrund, doch mit zunehmender Routine wächst bei manchen die Unsicherheit. Fragen tauchen auf: „Ist dieses Fach wirklich das Richtige für mich?“, oder „Wie sieht mein zukünftiger Arbeitsplatz nach dem Studium aus?“.
Solche Zweifel sind kein Zeichen von Schwäche, sondern Ausdruck einer gesunden Selbstreflexion. Sie zeigen, dass sich Studierende mit ihrer Identität, ihren Werten und Lebenszielen auseinandersetzen. Gerade in dieser Lebensphase, in der viele zum ersten Mal unabhängig sind, findet ein intensiver Prozess der Selbstfindung statt (BARMER Campus Coach, o. J.).
Gleichzeitig können Zweifel belasten. Wenn sie mit Erschöpfung, Schlafstörungen oder sozialem Rückzug einhergehen, besteht das Risiko, dass sich depressive Symptome entwickeln. Viele Betroffene merken zunächst nur, dass sie „keine Energie mehr“ haben oder ihnen das Lernen schwerfällt. Häufig kommt das Gefühl hinzu, dass alle anderen besser zurechtkommen.
Psychologisch betrachtet handelt es sich hier um eine Form der inneren Diskrepanz: das Auseinanderfallen von Erwartungen und erlebter Realität. Wer sich ursprünglich ein inspirierendes Studium vorgestellt hat, findet sich plötzlich in einem System aus Leistungsdruck, Prüfungsangst und ständiger Bewertung wieder. Diese Diskrepanz kann Stress verstärken und das Selbstwertgefühl schwächen.
Trotzdem hat diese Phase auch positive Seiten. Wer sich seinen Zweifeln stellt, kann neue Wege entdecken. Manche Studierende finden durch Reflexion zu einer klareren beruflichen Perspektive oder wechseln in ein Fach, das besser zu ihnen passt. Andere entwickeln Strategien, um besser mit Druck umzugehen. In diesem Sinn kann die Studienmitte eine wichtige Weichenstellung für persönliches Wachstum sein.
Dauerstress und Mehrfachbelastung
Viele Studierende finanzieren sich selbst, sei es durch Teilzeitjobs, Werkverträge oder Praktika. Diese Doppelbelastung aus Arbeit und Studium ist für viele nicht freiwillig, sondern notwendig, um Miete, Lebenshaltungskosten und Studiengebühren zu decken. Laut der Studierenden-Sozialerhebung der österreichischen Hochschüler:innenschaft arbeiten rund 69 % aller Studierenden neben dem Studium, im Durchschnitt etwa 21 Stunden pro Woche (ÖH, 2023). Der Preis dafür ist hoch: Wer tagsüber Vorlesungen besucht und abends arbeitet, hat kaum Zeit für Erholung oder soziale Kontakte.
Langfristig kann diese Mehrfachbelastung zu chronischem Stress, Konzentrationsproblemen und Müdigkeit führen. Studien zeigen, dass Studierende mit Erwerbstätigkeit häufiger unter depressiven Symptomen leiden und von einem Mangel an Schlaf berichten (Reitter et al., 2022). Hinzu kommt, dass die Grenzen zwischen Studium und Freizeit zunehmend verschwimmen, was den Körper zusätzlich beansprucht und das Risiko für eine Erkrankung erhöhen kann.
Hier können Stipendien und Förderprogramme eine große Entlastung sein. In Österreich gibt es neben staatlichen Studienbeihilfen auch zahlreiche private und themenspezifische Stipendien, die finanzielle Sorgen mildern können. Eine Bewerbung lohnt sich oft auch dann, wenn man glaubt, die Chancen seien gering. Viele Förderstellen achten nicht nur auf Noten, sondern auch auf Engagement, soziale Kriterien oder besondere Lebenssituationen. Wer finanzielle Unterstützung erhält, hat nicht nur mehr Zeit zum Lernen, sondern auch die Möglichkeit, Stressquellen zu reduzieren und die eigene Gesundheit zu schützen. Informationen dazu bietet unter anderem die Website https://www.stipendium.at/ an.

Trotz dieser Belastungen hat Arbeit während des Studiums auch positive Aspekte. Wer einer Tätigkeit nachgeht, sammelt Berufserfahrung, baut Selbstvertrauen auf und schafft finanzielle Unabhängigkeit. Arbeit kann auch soziale Zugehörigkeit fördern und den Alltag strukturieren. Entscheidend ist jedoch das Maß: Wird aus notwendiger Organisation dauerhafte Überforderung, kippt der Effekt ins Gegenteil.
Umgang und Prävention
Um langfristig gesund zu bleiben, ist es wichtig, einen realistischen Umgang mit Belastungen zu finden. Das bedeutet nicht, alle Herausforderungen zu vermeiden, sondern zu lernen, sich selbst zu regulieren.
Ein geregelter Tagesablauf, regelmäßige Pausen und ausreichend Schlaf sind einfache, aber entscheidende Faktoren. Bewegung wirkt erwiesenermaßen stressreduzierend und verbessert die Konzentration. Ebenso wichtig ist soziale Unterstützung. Freundschaften, Lerngruppen und Austausch mit Mitstudierenden helfen, das Gefühl der Isolation zu durchbrechen.
Viele Universitäten bieten mittlerweile Workshops und Trainings zur mentalen Gesundheit an. Themen sind etwa Stressbewältigung, Zeitmanagement, Achtsamkeit oder Prüfungsangst. Solche Angebote können eine wertvolle Ergänzung sein, um die eigene Resilienz zu stärken. Informationen dazu findet man bei der ÖH der jeweiligen Bildungseinrichtung.
Wer merkt, dass Überforderung zum Dauerzustand wird, sollte sich frühzeitig Hilfe holen. Je früher man reagiert, desto leichter lässt sich die Belastung abfedern. Beratungsgespräche können helfen, Prioritäten zu sortieren, realistische Vorhaben zu setzen und individuelle Strategien zu entwickeln.
Langfristig geht es darum, einen eigenen Rhythmus zu finden, der Leistung und Erholung in Balance hält. Das Studium ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Wer lernt, unterwegs gut für sich zu sorgen, kann diese intensive Lebensphase nicht nur bestehen, sondern auch gestärkt daraus hervorgehen.
Die Abschlussphase: Zwischen Leistungsdruck und Zukunftsangst
Am Ende des Studiums stehen häufig neue Belastungen im Vordergrund. Die letzten Semester markieren für viele eine intensive und gleichzeitig widersprüchliche Zeit. Einerseits ist die Freude da, dass die letzten Etappen des Studiums bevorstehen, andererseits wächst das Risiko, psychisch zu erschöpfen. Das Studium soll erfolgreich abgeschlossen werden, die Arbeit überzeugend sein, die Note stimmen. Gleichzeitig müssen administrative Aufgaben, Bewerbungen oder Praktika organisiert werden. Die Gedanken kreisen um Deadlines, Formalitäten und Zukunftsentscheidungen, während gleichzeitig die Energie vieler bereits aufgebraucht ist.
Abschlussarbeiten, Zeitdruck und Erschöpfung
Die Abschlussarbeit gilt oft als Höhepunkt des Studiums, gleichzeitig aber auch als ihre größte Herausforderung. Zum ersten Mal müssen viele eine längere wissenschaftliche Arbeit selbstständig planen, strukturieren und durchhalten. Das bringt Verantwortung, aber auch Unsicherheit mit sich.
Ein Belastungsfaktor ist der Perfektionismus. Manche Studierende möchten zeigen, was sie können, und setzen sich dabei unter massiven Druck. Die Angst, der eigenen oder der fremden Erwartung nicht gerecht zu werden, führt leicht zu Überforderung. Kleine Fortschritte fühlen sich unbedeutend an, während Rückschläge übermäßig belasten. Wer zu viel Zeit mit Korrekturen, Recherchen oder Formatierung verbringt, verliert schnell das Gefühl für den eigenen Fortschritt.
Hinzu kommt, dass viele parallel zu ihrer Abschlussarbeit arbeiten müssen, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Dadurch bleibt wenig Raum für Konzentration und Erholung. Auch äußere Faktoren wie unklare Betreuung, fehlendes Feedback oder bürokratische Hürden können zusätzlichen Stress erzeugen (Pfeiffer, 2023). Nicht selten berichten Studierende in dieser Phase von Erschöpfung, Schlafproblemen oder Selbstzweifeln. Warnzeichen, die ernst genommen werden sollten, um eine Erkrankung zu vermeiden.
Doch trotz dieser Schwierigkeiten ist die Abschlussarbeit auch eine wertvolle Erfahrung. Sie bietet die Gelegenheit, sich mit einem Forschungsfeld intensiv auseinanderzusetzen, eigene Kompetenzen zu zeigen und Selbstvertrauen aufzubauen. Viele Studierende erleben nach anfänglicher Unsicherheit ein starkes Gefühl der Zufriedenheit, wenn sie merken, dass sie diese Herausforderung bewältigen können.
Übergänge und Existenzfragen
Der Übergang vom Studium an einer Universität ins Berufsleben ist eine biografische Schwelle. Viele Studierende erleben ihn als ambivalent: einerseits befreiend, andererseits beängstigend. Nach Jahren mit klaren Strukturen, Fristen und Zielen fällt plötzlich ein Rahmen weg. Die Frage „Was mache ich jetzt?“ steht im Raum, manchmal begleitet von Sorge, ob das erworbene Wissen für den Arbeitsmarkt ausreicht oder ob man die „richtige“ Entscheidung getroffen hat.
Diese Unsicherheit betrifft alle Studierenden, zeigt sich aber unterschiedlich. Für Erstakademiker:innen, die in ihrer Familie als Erstes studiert haben, ist der Abschluss oft mit hohem Erwartungsdruck verbunden. Das Studium soll sich „lohnen“, finanziell, gesellschaftlich und persönlich. Wenn der Einstieg in den Arbeitsmarkt nicht sofort gelingt, entsteht leicht das Gefühl, versagt zu haben oder die Chancen nicht richtig genutzt zu haben. Auch die Orientierung im beruflichen Umfeld kann schwerfallen, wenn Erfahrungswerte oder Vorbilder fehlen.
Für Akademikerkinder wiederum zeigt sich der Druck in anderer Form. Viele spüren die unausgesprochene Erwartung, den Erfolg der Familie fortzuführen oder eine „würdige“ berufliche Laufbahn einzuschlagen. Wenn der Berufseinstieg nicht reibungslos verläuft oder die gewählte Richtung nicht den familiären Vorstellungen entspricht, entstehen innere Spannungen. Manche erleben Schuldgefühle, wenn sie sich beruflich anders orientieren oder „aus der Reihe tanzen“.
Beide Gruppen eint ein zentrales Gefühl: die Suche nach Orientierung in einer neuen Lebensphase. Der Abschluss markiert nicht nur das Ende eines Studiums, sondern auch den Beginn eines neuen Selbstverständnisses. Die eigene Identität verändert sich, vom Studierenden zur Berufseinsteigerin, vom Lernenden zur Verantwortlichen. Es ist eine Phase, in der Unsicherheit, Mut und Neuanfang eng miteinander verbunden sind.
Zwischen Krisen und Prävention
Studierende erleben nicht nur akademische, sondern auch persönliche Belastungen. Ereignisse, wie Trennungen, finanzielle Engpässe, Krankheit oder Einsamkeit können das psychische Gleichgewicht zusätzlich erschüttern. Nicht alle sind gleichermaßen betroffen. Faktoren wie finanzielle Sicherheit oder bereits bestehende psychische Erkrankungen, wie eine Depression, spielen eine essenzielle Rolle bei den Ursachen individueller Belastung. Umso wichtiger ist es, Risikofaktoren früh zu erkennen und Schutzfaktoren zu stärken.
Psychische Stabilität entsteht nicht über Nacht. Sie wächst mit Erfahrung, Selbstfürsorge und bewusster Auseinandersetzung mit den eigenen Bedürfnissen. Im Folgenden findest du fünf Tipps, die dir helfen können, schwierige Situationen zu überstehen und langfristig gesund zu bleiben.

Selbstreflexion
Wer regelmäßig innehält und sich fragt, was wirklich wichtig ist, kann besser mit Stress umgehen. Ein Studium, das zu den eigenen Interessen und Werten passt, mindert das Risiko von Überforderung. Selbstreflexion schafft Klarheit darüber, welche Erwartungen von außen kommen und welche tatsächlich die eigenen sind. Wer versteht, was ihn motiviert, kann Prioritäten setzen, Grenzen erkennen und bewusst Entscheidungen treffen, die langfristig guttun.
Resilienz entwickeln
Der Begriff Resilienz beschreibt die Fähigkeit, sich von Belastungen zu erholen und Probleme als Teil des Lebens anzunehmen. Sie kann trainiert werden: Durch Achtsamkeit, Bewegung und ausreichend Schlaf. Kleine Routinen, wie ein täglicher Spaziergang oder das Führen eines Dankbarkeitstagebuchs, können helfen, Belastungen in Relation zu setzen. Auch realistische Zielsetzung ist entscheidend: Wer sich erreichbare Zwischenziele setzt, erlebt häufiger Erfolgsmomente und stärkt so das Vertrauen in die eigene Bewältigungskompetenz.
Soziale Beziehungen pflegen
Soziale Unterstützung ist einer der stärksten Schutzfaktoren für psychische Gesundheit. Freundschaften, Lerngruppen und der Austausch mit Kommilitoninnen und Kommilitonen helfen, sich verstanden zu fühlen und die eigenen Sorgen zu relativieren. Wer sich in einer Gemeinschaft aufgehoben fühlt, trägt Belastungen leichter und kann Rückschläge besser verarbeiten. Auch kleine Gesten wie gemeinsame Lernzeiten oder Gespräche in der Pause wirken stabilisierend und fördern das Gefühl der Zugehörigkeit.
Wissen über psychische Gesundheit
Viele Hochschulen bieten mittlerweile Seminare, Workshops oder Online-Kurse zu Themen wie Stressbewältigung, Zeitmanagement, Achtsamkeit oder mentale Gesundheit an. Diese Angebote vermitteln Wissen über Zusammenhänge zwischen Psyche, Körper und Verhalten und helfen, Anzeichen von Überlastung früh zu erkennen. Wer versteht, wie Stress entsteht und welche Strategien dagegen wirken, kann bewusster handeln und vorbeugen. Schon einfache Übungen zur Atmung oder Konzentration können das Wohlbefinden spürbar verbessern und die Lernleistung steigern.
Gesunde Ernährung
Auch Ernährung spielt eine entscheidende Rolle für psychische Stabilität und Konzentrationsfähigkeit. Eine ausgewogene, nährstoffreiche Ernährung unterstützt das Gehirn dabei, effektiv zu arbeiten, und wirkt sich positiv auf Stimmung und Energielevel aus. Komplexe Kohlenhydrate, gesunde Fette, Obst und Gemüse fördern die Konzentration und stabilisieren den Blutzuckerspiegel, das beugt Erschöpfung und Stimmungsschwankungen vor. Wer regelmäßig und bewusst isst, anstatt Mahlzeiten auszulassen oder nur Kaffee und Snacks zu sich zu nehmen, bleibt fokussierter und ausgeglichener. Gesunde Ernährung ist somit nicht nur eine körperliche, sondern auch eine psychische Ressource, die im Studienalltag leicht unterschätzt wird.
Unterstützungsmöglichkeiten
Wie bereits im Beitrag erwähnt, bietet die Psychologische Studierendenberatung österreichweit kostenlose und vertrauliche Unterstützung für Studierende an. Sie ist das Zentrum für psychologische Beratung und Begleitung bei Themen wie Prüfungsangst, Überforderung, Entscheidungsproblemen oder persönlichen Schwierigkeiten und hilft dabei, frühzeitig Strategien zur Bewältigung zu entwickeln.

Ergänzend dazu bietet die Website von ÖH Helpline anonyme psychologische Erstberatung an. Das Angebot ist kostenlos, leicht erreichbar und richtet sich an Studierende, die in akuten Belastungssituationen schnelle Unterstützung benötigen oder einfach jemanden brauchen, der zuhört.
Auch Universitäten in Wien engagieren sich zunehmend für die mentale Gesundheit ihrer Studierenden. Die Universität Wien informiert über verschiedene Anlaufstellen und Beratungsangebote, die während des gesamten Studiums in Anspruch genommen werden können, von psychologischer Beratung bis zu Workshops rund um Stressbewältigung und Motivation. Darüber hinaus bietet die Sigmund Freud Privatuniversität Wien in ihrer Universitätsambulanz psychotherapeutische Begleitung für Personen an, die auch Studierenden offensteht und eine längerfristige Unterstützung in einem professionellen Rahmen ermöglicht.
Als zusätzliches Angebot steht die Website von Krisenchat Österreich zur Verfügung. Die Plattform bietet kostenlose, anonyme Soforthilfe per Chat: Rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. Geschulte Berater:innen und Psycholog:innen begleiten junge Menschen in Notlagen, bei Angst, Einsamkeit oder Überforderung. Der anonyme Zugang erleichtert es vielen, über schwierige Themen zu sprechen, insbesondere dann, wenn der Schritt in eine persönliche Beratung noch zu groß erscheint.
Diese vielfältigen Angebote zeigen: Unterstützung ist da und sie ist erreichbar. Wer Hilfe frühzeitig annimmt, kann Belastungen abfedern, innere Ressourcen stärken und das Studium nicht nur erfolgreich, sondern auch gesund abschließen.
Fazit
Das Studium ist eine Zeit intensiver persönlicher Entwicklung. Es fordert nicht nur den Geist, sondern auch die Psyche. Zwischen Studienanfang, Alltag und Abschluss erleben viele Studierende Phasen von Überforderung, Selbstzweifeln und Erschöpfung. Diese Erfahrungen sind keine Ausnahme, sondern Teil eines Systems, das hohe Anforderungen stellt und oft zu wenig Raum für mentale Gesundheit lässt.
Psychische Belastungen im Studium sind kein individuelles Versagen, sondern Ausdruck gesellschaftlicher und struktureller Bedingungen. Leistungsdruck, Geldsorgen und die Suche nach Orientierung treffen auf eine Lebensphase, in der viele erst herausfinden, wer sie sind und wohin sie möchten.
Umso wichtiger ist es, offen über mentale Gesundheit zu sprechen und sich bewusst zu machen, dass Hilfe zu suchen kein Zeichen von Schwäche ist, sondern ein Schritt zu Stabilität und Selbstfürsorge. Wer Unterstützung annimmt, kann innere Ressourcen stärken, Belastungen abfedern und das Studium nicht nur erfolgreich, sondern auch gesund abschließen. Mentale Gesundheit ist kein Luxus, sie ist die Voraussetzung dafür, das eigene Potenzial wirklich entfalten zu können.
Quellen
BARMER Campus Coach. (o. J.). Zweifel am Studium verstehen und überwinden. https://www.barmer-campus-coach.de/blog-zweifel-am-studium-verstehen-und-ueberwinden
Österreichische Hochschüler:innenvertretung. (o. J.). Helpline – psychologische Erstberatung. Abgerufen am [22.10.2025], von https://www.oeh.ac.at/helpline/
Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH). (2023, 29. Oktober). Studierende sind gezwungen, immer öfter und mehr zu arbeiten – SOLA23 zeigt alarmierende Entwicklung. APA-OTS. https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20241029_OTS0070/oeh-ad-sola23-studierende-sind-gezwungen-immer-oefter-und-mehr-zu-arbeiten
Psychologische Studierendenberatung Österreich. (2024). Beratung und Psychotherapie für Studierende. Abgerufen am [22.10.2025], von https://www.studierendenberatung.at
Reitter, H. S., et al. (2022). Stress und psychische Gesundheit bei Studierenden in Österreich. Psychologie in Österreich, 4–5, 207–220.
Kirchgeorg, M. (2018, 15. Februar). Kognitive Dissonanz – Definition. In Gabler Wirtschaftslexikon. Springer Fachmedien Wiesbaden. https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/kognitive-dissonanz-37371/version-260807
Krisenchat Österreich. (o. J.). Kostenlose & anonyme Hilfe per Chat – rund um die Uhr. Abgerufen am [22.10.2025], von https://www.krisenchat.de/?gad_source=1&gad_campaignid=11661717769&gbraid=0AAAAABxOo1Xu4W3zYTuZpYQAqAQrDXk8q&gclid=CjwKCAjwgeLHBhBuEiwAL5gNEYJP300JETI_lwO0Q9L0ZdKYnaRLUsB6N_EN_K3kgGgOxk3FeVfkghoCLNUQAvD_BwE
Pfeiffer, F. (2023, 7. August). Den perfekten Betreuer deiner Bachelorarbeit finden - So geht’s. Scribbr. https://www.scribbr.at/anfang-abschlussarbeit-at/bachelorarbeit-betreuer/
Sigmund Freud Privatuniversität. (o. J.). Psychotherapie | Universitätsambulanz | SFU Wien. Abgerufen am [22.10.2025], von https://ambulanz.sfu.ac.at/de/erwachsene/angebote/psychotherapie/
Schröter, L. (2024, 18. November). Hast du Schuldgefühle beim Abgrenzen von deinen Eltern? Hier ist, wie du sie überwindest [Blogbeitrag]. Lisa Schröter Blog. https://lisaschroeter.de/blog/life-mindset-veraendern/schuldgefuehle-eltern/
Stoeber, J., & Otto, K. (2006). Positive conceptions of perfectionism: Approaches, evidence, challenges. Personality and Social Psychology Review, 10(4), 295–319.
Studienbeihilfenbehörde. (o. J.). Stipendium.at. Abgerufen am 15. Oktober 2025, von https://www.stipendium.at/
Universität Wien. (o. J.). Psychologische Studierendenberatung | Angebot der Universität Wien. Abgerufen am [22.10.2025], von https://stv-lehrerinnenbildung.univie.ac.at/beratung/weitere-beratungsangebote/psychologische-studierendenberatung/


.jpg)
.jpg)



